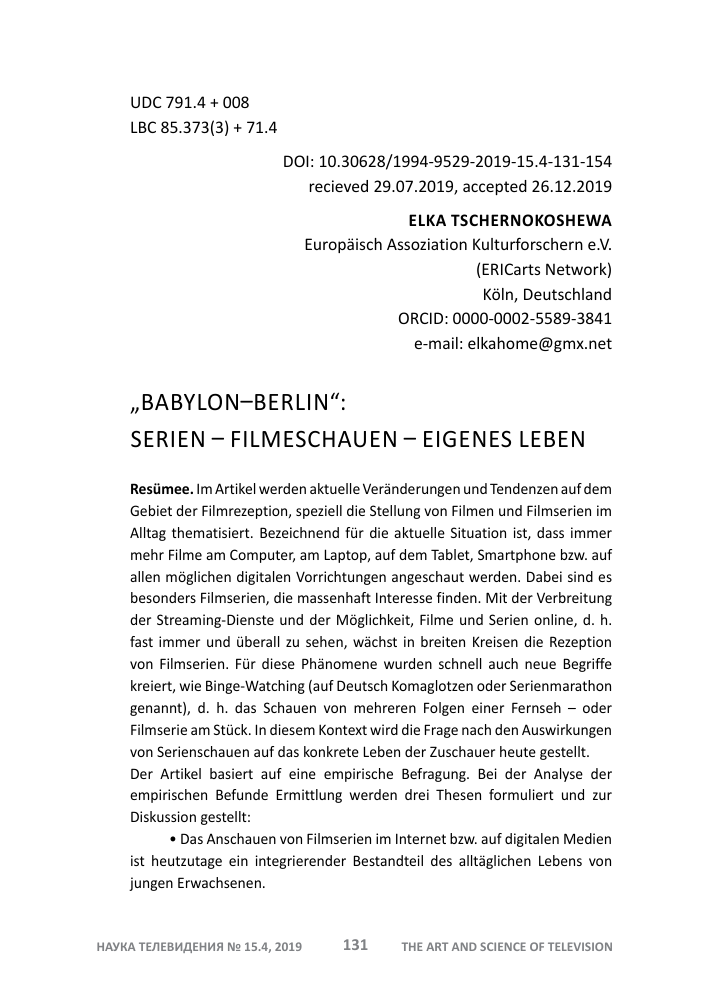UDC 791.4 + 008 LBC 85.373(3) + 71.4
DOI: 10.30628/1994-9529-2019-15.4-131-154 recieved 29.07.2019, accepted 26.12.2019
ELKA TSCHERNOKOSHEWA
Europäisch Assoziation Kulturforschern e.V.
(ERICarts Network) Köln, Deutschland ORCID: 0000-0002-5589-3841 e-mail: elkahome@gmx.net
„BABYLON-BERLIN":
SERIEN - FILMESCHAUEN - EIGENES LEBEN
Resümee. Im Artikel werden aktuelle Veränderungen und Tendenzen auf dem Gebiet der Filmrezeption, speziell die Stellung von Filmen und Filmserien im Alltag thematisiert. Bezeichnend für die aktuelle Situation ist, dass immer mehr Filme am Computer, am Laptop, auf dem Tablet, Smartphone bzw. auf allen möglichen digitalen Vorrichtungen angeschaut werden. Dabei sind es besonders Filmserien, die massenhaft Interesse finden. Mit der Verbreitung der Streaming-Dienste und der Möglichkeit, Filme und Serien online, d. h. fast immer und überall zu sehen, wächst in breiten Kreisen die Rezeption von Filmserien. Für diese Phänomene wurden schnell auch neue Begriffe kreiert, wie Binge-Watching (auf Deutsch Komaglotzen oder Serienmarathon genannt), d. h. das Schauen von mehreren Folgen einer Fernseh - oder Filmserie am Stück. In diesem Kontext wird die Frage nach den Auswirkungen von Serienschauen auf das konkrete Leben der Zuschauer heute gestellt. Der Artikel basiert auf eine empirische Befragung. Bei der Analyse der empirischen Befunde Ermittlung werden drei Thesen formuliert und zur Diskussion gestellt:
• Das Anschauen von Filmserien im Internet bzw. auf digitalen Medien ist heutzutage ein integrierender Bestandteil des alltäglichen Lebens von jungen Erwachsenen.
• Das Anschauen von Filmserien im Netz ist eine Strategie der Lebensbewältigung.
• Das Anschauen von Filmserien geht mit einer Steigerung der Bedeutung des eigenen Lebens einher. Dies bedeutet einerseits Erweiterung der persönlichen Freiheit und Unabhängigkeit, zugleich aber auch eine neue Begrenzung und Limitierung der Handlungsfähigkeit.
Der Text schließt mit der Vision für eine intersubjektive Kulturforschung ab. Schlüsselbegriffe: Filmserien, Filmproduktion in Deutschland, Kultur, empirische Kulturforschung, Filmeschauen, Binge-Watching, Komaglotzen, Alltag, Alltagskultur, Eigenes Leben, Jugendkultur, Serien, Serialität, Beziehungen, Intersubjektivität
ELKA TSCHERNOKOSHEWA
The European Association of Cultural Researchers e.V.
(ERICarts Network) Cologne, Germany ORCID: 0000-0002-5589-3841 e-mail: elkahome@gmx.net
„BABYLON-BERLIN": SERIES-FILM SHOWS-OWN LIFE
Abstract. The article deals with current changes and tendencies in the field of film viewing modes, and especially with the importance of film and film series viewing in everyday life. The current situation is characterised by the fact that more and more films are viewed on computers, laptops, tablets, smartphones and all kinds of digital devices. In particular, it is film series that are of mass interest. With the spread of streaming services and the possibility of watching films and series online, i.e. almost always and everywhere, the consumption of film series is growing in broad circles. New terms were quickly created for these phenomena, such as binge-watching or binge-viewing (Komaglotzen or Serienmarathon in German) or series addiction, i.e. watching several episodes of a television or film series at a time. In this context, the question of the effects of series shows on the concrete lives of viewers today is posed.
The article is based on an empirical survey. In the analysis of the empirical findings, three theses are formulated and put up for discussion:
• Nowadays, watching film series on the Internet or on digital media is an integral part of the everyday life of young adults.
• Watching film series on the Internet is a strategy for coping with life.
• Watching film series goes hand in hand with giving meaning to one's own life. On the one hand, this means an expansion of personal freedom and independence, but at the same time also a new limitation of the ability to act. The text concludes with a vision for intersubjective cultural research. Keywords: Film series, film production in Germany, culture, empirical cultural research, film shows, binge-watching, everyday life, everyday culture, own life, youth culture, series, seriality, relationships, intersubjectivity
„BABYLON-BERLIN" Im Jahre 2018 hat die Filmserie „Babylon-Berlin" einige der renommierten deutschen Film- und Fernsehpreise bekommen. Die Auszeichnungen reichen von Bambi, über den deutschen Fernsehpreis bis Grimme Preise in mehreren Kategorien hin. Die Filmserie spielt in Berlin Ende der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts und gehört zu der Kategorie der Kriminalfilme, resp. der historischen Kriminalfilme. So lautet pointiert die Ankündigung auf dem DVD-Cover des Films: „Berlin. Im Frühjahr 1929. Eine Metropole in Aufruhr. Spekulation und Inflation zehren bereits an den Grundfesten der immer noch jungen Weimarer Republik. Wachsende Armut und Arbeitslosigkeit stehen in starken Kontrast zu Exzess und Luxus des Nachtlebens und der nach wie vor überbordenden kreativen Energie der Stadt."
Die Filmserie war zunächst auf zwei Staffeln je 8 Episoden angelegt. Im März 2019 kam die Meldung in der Presse, dass eine dritte Staffel in Vorbereitung sei, so dass 12 neue Episoden kommen sollten, zunächst auf Sky - Pay-TV Ende 2019 und dann auf ARD im Herbst 2020. „Die Dreharbeiten zur dritten Staffel von „Babylon Berlin" sind beendet" - können wir im Juni 2019 beim ARD Die Erste lesen. Bei diversen Ankündigungen über den Film wird wiederholt über eine „einzigartige Erfolgsgeschichte" berichtet.
Die Regiearbeit an dieser umfangreichen und bei weitem anspruchsvollen Filmproduktion wird von den bekannten Regisseuren Tom Tykwer, Achim von Borries und Henk Handloegten realisiert. Die Drehbücher der ersten beiden Staffeln basieren frei auf Volker Kutschers Kriminalroman „Der nasse Fisch". Die dritte Staffel basiert auf dem Volker Kutscher-Roman „Der stumme Tod", dem zweiten Fall der Bestseller-Reihe um den Kommissar Gereon Rath. Hauptdarsteller sind Volker Bruch in der Rolle des Kommissars und Liv Lisa Fries als Charlotte „Lotte" Ritter, die ebenfalls bei der Polizei arbeitet. In Nebenrollen sind u. a. renommierte Schauspieler wie Jens Harzer oder auch aufsteigende Talente wie Leonie Benesch zu sehen.
Am 28. September 2017 hatte die Serie Premiere mit einer exklusiven Aufführung im Theater am Schiffbauerdamm, einem der Drehorte des Films. Die Ausstrahlungsmodalitäten von „Babylon-Berlin" zeigen neue Entwicklungen in den Bereichen von Filmvertrieb und Filmrezeption. Die
Ausstrahlung der ersten Staffel erfolgte zunächst beim Bezahlsender Sky -und dies wöchentlich vom 13. Oktober bis zum 3. November 2017, jeweils als Doppelfolge um 20:15 Uhr auf dem Kanal Sky 1. Die Ausstrahlung der zweiten Staffel begann dort am 10. November 2017, wiederum wöchentlich als Doppelfolge. Seit dem 17. November 2017 standen alle Folgen der zweiten Staffel auf Sky Go online, sodass auch die Folgen 4-8 an diesem Tag Premiere hatten.
Erst einige Zeit später, also ab dem 30. September 2018 wurde „Babylon-Berlin" regulär im Fernsehen ausgestrahlt. In Deutschland war der Film im Ersten Programm (ARD), in der Schweiz auf SRF zwei und in Österreich in ORF eins zu sehen. Interessant für unsere Thematik und ein Novum auf dem Bereich der Filmrezeption ist, dass die Serie gewisse Zeit vor der linearen Ausstrahlung im Fernsehen (ARD) bereits in der Mediathek der Sender zu sehen war.
In kurze Zeit erreichte die Filmserie hohe Zuschauerzahlen. Die Erstaus-strahlung der ersten drei Episoden von „Babylon-Berlin" im Free-TV wurde am 30. September 2018 im Ersten in Deutschland von 7,83 Millionen Zuschauern gesehen. Dazu kommen noch die Zuschauer bei Sky 1. In den ersten sechs Tagen schafften es die beiden ersten Episoden auf insgesamt 1,19 Millionen Zuschauer. Dies gilt laut Pressebericht als „den zweiterfolgreichsten Serienstart auf einem Sky-Sender". Dazu kommt noch der Verkauf der Staffeln für private Haushalte. Hier der Bericht auf der ARD-Portal: „Die Quotenbilanz der Free-TV-Premiere im Ersten war hervorragend: Durchschnittlich sahen fast fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die 16 Folgen. In der Mediathek der ARD ist BABYLON BERLIN ein noch nie dagewesener Erfolg: Mehr als zehn Millionen Videoabrufe wurden registriert. Auch auf Sky zog die Serie Millionen von Zuschauern in ihren Bann: BABYLON BERLIN zählt damit zu der erfolgreichsten Serie auf Sky überhaupt."1
1 Einzigartige Erfolgsgeschichte // ARD1:
URL: https://www.daserste.de/unterhaltung/serie/babylon-berMn/babylon-berMn-dreharbeiten-dritte-staffel100.html (24.06.2019).
Was die Finanzierung der Serie betrifft, so sind diesbezüglich auch Neues zu verzeichnen. Die Serie war zunächst auf 16 Folgen von jeweils rund 45 Minuten in zwei Staffeln angelegt. Sie gilt mit einem Budget von knapp 40 Millionen Euro bzw. 2,5 Millionen Euro pro Folge als die bislang teuerste deutsche Fernsehproduktion und teuerste nicht-englischsprachige Serie. Dabei wurde zum ersten Mal in Deutschland eine Serie von der beitragsfinanzierten ARD, dem Pay-TV-SenderSky, X Filme und Beta Film koproduziert. Diese Mischfinanzierung gibt neue Möglichkeiten für die Filmproduktion, birgt aber auch spezifische Einschränkungen und Abhängigkeiten. Zudem sind in der Produktion der Serie auch Mittel aus öffentlicher Hand eingeflossen. Das Projekt wird unter anderem vom Medienboard Berlin-Brandenburg, der Filmstiftung und Medienstiftung NRW, dem German Motion Picture Fund und dem Media Programm der Europäischen Union unterstützt. Der Sender ARD bezeichnet diese neue Mischfinanzierung als wegweisende Finanzierung, welche derart aufwendige deutsche Fernsehformate auch zukünftig möglich machen sollte. Dennoch gibt es hier auch eine Reihe von Diskussionspunkten, die Finanzierung der Serie kann somit keineswegs als unumstritten gelten.
Die Serie „Babylon-Berlin" ist zudem speziell und zielgerichtet auch für den internationalen Vertrieb hergestellt worden. Diese Ausrichtung ist eine wesentliche Komponente der gesamten Filmproduktion von „Babylon-Berlin". Die Serie wurde bereits in über 100 Länder verkauft und hat auch internationale Fernsehpreise und Auszeichnungen gewonnen, u. a. die österreichische „Romy", den spanischen Fernsehpreis „Premios Onda" sowie den „Magnolia Award" des Shanghai TV Festivals. Die Ausstrahlungsrechte für die USA sicherte sich Netflix, wodurch eine weltweite Verbreitung und zahlenreiche Rezeption des Films lanciert wurde.
Bild 2: Babylon-Berlin, Staffel 1, eigene Aufnahme
BINGE-WATCHING Ich habe die Serie „Babylon-Berlin" angeführt, nicht um eine filmwissenschaftliche Analyse im engeren Sinne zu machen, sondern um auf einige Veränderungen und neue Tendenzen auf dem Gebiet der Filmrezeption hinzuweisen. Die konkrete Situation der Filmrezeption bewirkt wesentliche Veränderungen und Modifizierungen auf dem gesamten Gebiet der Filmproduktion. Von der Stellung des Mediums Film im Alltag der Rezipienten entscheidet sich viel darüber, welche Formate und Inhalte produziert und somit künstlerisch wie gesellschaftlich relevant werden. In diesem Sinne finde ich schlüssig, die Frage nach der Rezeptionssituation ins Zentrum der kulturwissenschaftlichen Forschung zu stellen.
Was die Filmrezeption betrifft, so zeigt sich in den letzten Jahren verstärkt die Tendenz Filme am Computer, am Laptop, auf dem Tablet, dem Mobile, Smartphone bzw. auf allen möglichen digitalen Vorrichtungen zu sehen. Diese neue Rezeptionssituation geht zusammen mit einer
Veränderung aller Parameter der Filmanschauung selbst: Was gesehen wird; wie lange im Stück geschaut wird; mit wem oder ob es doch allein geschieht; welche Medienprovider respektive welche digitalen Dienste dabei in Anspruch genommen werden. Mit der Verbreitung der Streaming Dienste und der Möglichkeit Filme und Serien online, d. h. fast immer und überall zu sehen, wächst in breiten Kreisen die Rezeptionsbereitschaft. Für diese Phänomene wurden schnell auch neue Begriffe kreiert, wie Binge-Watching oder Binge-Viewing (engl. binge = Gelage), auf Deutsch Komaglotzen oder Serienmarathon, bzw. Seriensucht genannt. Unter Binge-Watching versteht man das Schauen von mehreren Folgen einer Fernseh- oder Filmserie am Stück. Ein Beleg für die enorme Verbreitung dieses Phänomens zeigt sich bereits darin, dass das Collins English Dictionary im Jahre 2015 das neu kreierte Wort Binge-Watching zum Wort des Jahres erklärte.
Vieles zeugt davon, dass es sich hier um einen kulturellen Trend handelt, der insbesondere durch die steigende Popularität und Verfügbarkeit von Video-on-Demand-Angeboten begünstigt wird, d. h. durch die Möglichkeit digitale Videos auf Anfrage von einem Online-Dienst herunterzuladen oder per Streaming direkt anzusehen. Diese technischen Errungenschaften ermöglichen dem Zuschauer Videomaterial jederzeit auf Anfrage über einen Streaming Dienst anzuschauen. Im Gegensatz zum linearen Fernsehen, bei dem das Programm durch den Fernsehsender vorgegeben wird und üblicherweise die Folgen einer Staffel über mehrere Monate Ausstrahlung finden, können bei Video-on-Demand-Angeboten mehrere Folgen hintereinander am Stück angeschaut werden.
Zwar ist Binge-Watching schon seit der Erfindung der Videokassette und auch durch die Veröffentlichung kompletter Serienstaffeln auf DVD möglich, jedoch wurden generell die einzelnen Folgen zuvor im Fernsehen ausgestrahlt. Besondere Relevanz hat Binge-Watching dann, wenn Video-on-Demand-Anbieter wie Netflix oder Prime Video alle Folgen einer Staffel zur Premiere gleichzeitig veröffentlichen. Laut einer Netflix-Umfrage schauen Nutzer beim „Binge-Watching" durchschnittlich zwei bis sechs Folgen einer Serie am Stück. Wenn eine Folge rund 60 Minuten dauert, so bedeutet dies,
dass einige Netflix-Nutzer bis zu 6 Stunden am Stück eine Serie schauen. Auch soll es Nutzer geben, die die ganze Staffel am Stück schauen [1].
Die Kulturwissenschaft steht heute vor der Aufgabe diese neuen Tendenzen und Trends zu beleuchten, speziell die Stellung von Filmen und Filmserien in der Gesellschaft, wie im konkreten Alltagsleben der Zuschauer. Die Aufgabe ist umso dringlicher, da in pädagogischen und psychologischen Abhandlungen bereits Diskussionen geführt werden, welche eher auf die Gefahren von Binge-Watching hinweisen. Im alten Erziehungsmodus werden Rezeptionspraktiken besonders bei jungen Leuten kritisiert und zugleich der Anspruch erhoben, diese Alltagspraxen zu regulieren und zu kontrollieren. Viel weniger wird in diesen Texten der Aspekt von freien Wahlmöglichkeiten und aktiver Handlung berücksichtigt.
In letzter Zeit mehren sich Meldungen über die angeblichen Gefahren des Binge-Watching, ohne dabei die kulturelle Spezifik dieses Phänomens zu berücksichtigen. So wird über Studien berichtet, dass Binge-Watching dem Gedächtnis schaden soll: „Das haben Forscher der University of Melbourne herausgefunden. Bing-Watcher hatten in dem Experiment, Probleme sich an Handlungen und den Inhalt einer Serie zu erinnern. Dies ist darin begründet, dass durch fehlende Pausen Wissen nicht konsolidiert und verarbeitet werden konnte. Bing-Watcher waren schlichtweg von der Masse an Informationen überfordert. Das spiegelte sich in der eingeschränkten kognitiven Leistungsfähigkeit wider."2
Interessant scheint mir, dass in solchen Texten wie hier Serienschauen unreflektiert unter einen eng gefassten Lernaspekt befragt wird. Unterhaltungs- bzw. andere kommunikative Aspekte bleiben hier völlig unberücksichtigt. Wenn nur unter diesem eng gefassten Bildungsaspekt geforscht wird, dann werden auch weitere Gefahren von Binge-Watching hervorgehoben, z. B., dass der Tagesrhythmus durcheinandergebracht wird: „Das Binge-Watching verführt dazu, lange und bis spät in die Nacht
2 Was ist Binge-Watching? Bedeutung, Definition, auf deutsch, Übersetzung // Bedeutung Online: Insider, Phänomene und Sprache erklärt:
URL: https://www.bedeutungonNne.de/was-ist-binge-watching-bedeutung-definition-auf-deutsch-uebersetzung (25.06.2019).
hinein eine Serie zu schauen, so dass später als üblich schlafen gegangen wird. Das bringt die Schlaf- und Wachzeiten durcheinander. Dies hat Einfluss auf die Schlafqualität und damit auch auf die kognitive Leistungsfähigkeit." Die Ausführungen über Gefahren gehen weiter: „Binge-Watching kann auch dazu führen, dass Zuschauer auf Schlaf und Sport verzichten, um eine Serie zu schauen. Außerdem führt Binge-Watching zu Bewegungsmangel. Dadurch, dass eine Reglementierung der Serien fehlt, fällt es sehr leicht mehrere Episoden am Stück zu schauen. Der Zugang zu einer Serie ist einfach, einen Mausklick entfernt und unbeschränkt. Psychologische Effekte wirken ebenfalls. Zuschauer freunden sich mit Serienfiguren an und empfinden eine gewisse Zugehörigkeit. Durch Spannungsbögen gut erzählter Serien wollen Zuschauer stets wissen, wie es weitergeht."3
Die Kulturforschung kann in dieser Diskussion einen wichtigen Beitrag leisten. Ich finde wichtig, dass wir uns hier fachkundig einmischen, denn es geht um die große Frage nach Freiheit und Selbstbestimmung unter den aktuellen Bedingungen von fortgeschrittener Globalisierung und Digitalisierung. In diesem Kontext sollten wir die Frage nach der Spezifik von Serien und Serialität als kulturelle Phänomene stellen. Es geht dabei auch um den alten Disput der Kunstwissenschaften um Original und Kopie, um Kunst und Reproduzierbarkeit, Bildung und Unterhaltung, nicht zuletzt um Elite und Masse. Auf eine allgemeinere philosophische Ebene geht es letztendlich um die große Frage nach dem Umgang mit Dualismen. So sehe ich hier eine enorme Herausforderung von der kulturwissenschaftlichen Forschung und ein neues Feld, in dem wir uns als Forscher und Forscherinnen positionieren sollten.
EMPIRISCHER BEFUND Um einen ersten Einblick in diese Thematik zu gewinnen, habe ich in der Zeit Februar - März 2019 eine kleine Befragung gemacht.
3 Was ist Binge-Watching? Bedeutung, Definition, auf deutsch, Übersetzung // Bedeutung Online: Insider, Phänomene und Sprache erklärt:
URL: https://www.bedeutungonline.de/was-ist-binge-watching-bedeutung-definition-auf-deutsch-uebersetzung (25.06.2019).
Die Befragung erfolgte durch E-Mails. In dieser Zeit habe ich 19 junge Erwachsene zwischen 30 und 40 Jahre befragt. Die Befragten haben durchweg eine abgeschlossene Hochschul- oder Berufsausbildung, sie haben ganz unterschiedliche Berufsfelder, stehen bereits im Arbeitsleben, leben in einer Stadt in Deutschland. Ich habe für die Untersuchung drei kurze Fragen gestellt. Die Antworten umfassen zwischen 1/2 bis 2 Seiten. Die Befragung hat keinen repräsentativen Charakter, doch bereits an diesem Material lassen sich einige schlüssige Tendenzen herausarbeiten. Meine Beobachtungen habe ich in drei Thesen zusammengefasst:
Erste These:
Das Anschauen von Filmserien im Internet bzw. auf digitale Transformationsmittel ist heutzutage ein integraler Bestandteil des alltäglichen Lebens von jungen Erwachsenen.
Auf die Frage, wie viele Stunden durchschnittlich in einer Woche schauen Sie Filmserien, variierten die Antworten zwischen 7 und 16 Stunden. Nur eine Person antwortete, dass sie digital keine Filmserien schaut. In der Regel werden am Stück, d. h. ohne Unterbrechung zwei Folgen geschaut - „im Winter etwas mehr als im Sommer" - wie eine Befragte es formuliert hat. Die Tatsache, dass digitale Transformationsmittel Einem die Möglichkeit geben selbst zu entscheiden, wann, wo und wie viele Filmserien angeschaut werden und nicht, wie im linearen Fernsehen zu warten, wann die nächste Folge kommt, wurde nicht nur positiv bewertet, sondern geradezu als selbstverständlich hingenommen. Für die Generation junge Leute, die mit Computer, Internet und immer neuen digitalen Medien aufgewachsen sind, ist dies eher „die Normalität". Einige von meinen Informanten berichteten, dass sie kein Fernsehgerät besitzen, bzw.: "normales Fernsehen" schauen wir gar nicht mehr."
Wenn wir die aktuelle Stellung von Filmserien im Alltag der jungen Leute verstehen wollen, so sind es besonders zwei Begriffe bzw. Begriffsfelder, die wir in der Debatte heranziehen sollten. Es handelt sich um die Begriffe Alltag und Serie bzw. Serialität als kulturwissenschaftlich/ anthropologische/philosophische/ Kategorien.
Der Begriff Alltag ist eine wesentliche Kategorie der Kulturforschung. Das wissenschaftliche Interesse am Alltag ist eng verbunden mit der industriellen Revolution und der Verbreitung der Massenkommunikationsmittel, besonders auch mit dem Herauskommen des Films als neues Kunst- und Kulturphänomen. Mit dem Medium Film wurde die klassische Ästhetik und Kunstvorstellung wesentlich infrage gestellt, durchdacht und neu definiert [2]. Hier kann ich nicht auf diese weitführende Debatte eingehen, es sei beispielhaft nur auf Walter Benjamins Text „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit" hingewiesen. Benjamin führt hier der Begriff der Aura ein und fasst es so zusammen: „was im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit des Kunstwerts verkümmert, das ist seine Aura." [3, s. 13]. Benjamins Essay ist bereits im Jahre 1935 entstanden, die breite Diskussion über Alltag, Kultur und Massenkunst hat erst in den späten 70er und 80er Jahre des 20. Jahrhunderts die etablierten Universitäten und Forschungseinrichtungen erreicht. Bis heute gibt es auf dem Feld Streitgespräche, die immer wieder neu mit jedem neuen Medium - sei es Fernsehen, Computerspiele oder Internet - entflammen und nach der alten Aura der Kunst sehnsüchtig trachten.
Was den Begriff Alltag betrifft, so fasse ich das nicht als Gegenteil von Feiertag oder Festtag, auch nicht allein unter den Aspekt der Wiederholbarkeit und Häufigkeit. Unter Alltag verstehe ich jenen Punkt der Berührung und Interaktion, bei welchen objektiven Koordinaten und Strukturen der Gesellschaft mit subjektiven Begebenheiten und Befindlichkeiten zusammentreffen. Der Begriff Alltag beinhaltet die historisch-konkrete Situation in eine Gesellschaft, samt Technik, Ökonomie, Politik, aber auch wie diese Aspekte mit dem konkreten Leben von Individuen korreliert. Wenn wir Alltag als Forschungsfeld wählen, dann sind wir auf das Studium der Gesamtheit der Beziehungen, d. h. der Handlungsspielräume und Handlungsmuster von Individuen ausgerichtet. Wir fragen nach den Bedingungen, unter denen individuelles Leben stattfindet, zugleich untersuchen wir aber auch wie der handelnde Mensch die objektiven und historischen Bedingungen seiner Existenz versteht,
aneignet, reflektiert und verändert. Zudem tut er dies als Einzelner und im Kollektiv, in seiner sozialen Gruppe und transgenerativ, was auch in unserer Forschung beleuchtet werden soll. Das Anschauen von Filmserien im Netz ist in diesem Sinne ein fester Bestandteil des Lebens der jungen Leute unter den neuen Bedingungen der Globalisierung, der digitale Revolution und der Marktwirtschaft.
Was die Serialität betrifft, so sind diverse Ansätze für eine Definition der Serie und der Serialität vorhanden [4; 5]. Mehrere Forscher kommen zu der Aussage, dass Serialität unterschiedlich ausfallen könne, so dass diverse Aspekte zu berücksichtigen und Typen zu unterscheiden sind. Besonders anregend für unsere Fragestellung finde ich Umberto Ecos Überlegung, dass die kulturwissenschaftliche Beschäftigung mit Fragen von Serien und Serialität den immer noch oft sehr tiefen Graben zwischen Hochkultur und - oft als minderwertig eingestufter - Populärkultur zu überbrücken helfen kann [6]. Nach Ecos Ansicht eignet sich das Phänomen der Serialität dafür besonders gut, da Serien in verschiedenen Epochen und Genres der Kunst existiert haben, so dass historische Dynamiken hier aufgezeigt werden können. Dabei kann schlüssig belegt werden, dass die Trennung von Hoch- und Populär- bzw. Hoch- und Unterhaltungskultur sich erst in der Romantik, also in der Zeit um 1800 ausgebildet hat. Dazu gehört auch die Tatsache, dass sich serielle Phänomene in der Kunst (z. B. der Fortsetzungsroman in Zeitschriften, später Serien im Rundfunk und schließlich im Fernsehen oder Netz) vor allem in den populärkulturellen Medieninhalten etabliert haben. Umberto Eco weist darauf hin, dass diese strikte Trennung in anderen Kulturen nicht so dominant ist, so sei z. B. ein serieller Aspekt in der orientalisch-islamischen Ornamentik enthalten, ohne den ästhetischen Charakter dieser Artefakte zu schmälen. Es ist eher der klassische westliche Kunstbegriff, der Kunst im Wesentlichen als etwas „Neues", „Originelles", als „Innovation" versteht und von jedem Kunstwerk das Erschaffen neues Paradigma abverlangt, um ihn als Kunst einzustufen. Wir können es hier mit Walter Benjamin auch „Aura" nennen. Die Serie hingegen, die einzelnen Folgen einer Serie, enthält viele Wiederholungselemente und hat nicht den Anspruch auf Einmaligkeit.
Iteration und Repetition sind bei der Serie charakterisierende Zugriffe, die dennoch ästhetische und künstlerische Legitimation haben. Es war zunächst der Begriff Unterhaltung, der in der Kulturforschung ein neues Paradigma eröffnete [7].
Für unsere Thematik ist noch eine Überlegung von Eco schlüssig: er kritisiert scharf die fürsorgliche Annahme eines gefährdeten Lesers bzw. Zuschauers. Gerade in der Medienpädagogik wird immer wieder ein „den Medieninhalten passives Ausgesetzt-sein" angenommen, das Eco jedoch zugunsten der differenzierten Annahme des intelligenten, aktiven Zuschauers oder Lesers auflöst. Er beschreibt einen Modell-Rezipienten, der mit ironischer Rezeptionshaltung auch populärkulturelle Massenprodukte unterhaltend und kritisch zur Kenntnis nehmen kann. Sicherlich gibt es auch passive, „naive" Rezipienten, wie Eco sie nennt, welche die „Gemachtheit" der Serien nicht im Blick haben und sich nur „berieseln lassen", doch die Ursachen dafür müssen gesellschafts-politisch studiert und nicht am Seriellen festgemacht werden. Das banalste Erzählprodukt kann eine kritische Lesart erzeugen - dies kann nicht oft genug wiederholt werden. Mein empirischer Befund gibt auch in dieser Richtung ausreichend Stoff zum Nachdenken.
Zudem stehen Alltagskultur und Serialität als Begriffe eng beieinander. Eco führt hier das Stichwort „Mythos" ein und unterstreicht: „Jede Epoche hat ihre eigenen Mythenmacher, ihren eigenen Begriff vom Heiligen" [6, s. 323]. Ein Mythos ist zunächst keine Kunst, sondern vor allem eine Erzählung. Bei der Rezeption von Mythen handelt es sich um den Genuss an der Wiederholung einer beständigen Wahrheit. Die Serie funktioniert nach Ecos Ausführungen gerade durch ihre Wiederholungsstruktur als weltlicher Mythenträger und profaner, d. h. nichtsakraler Mythenproduzent. Der ganze Akt der Rezeption ist emotional, befriedigend, kathartisch und vor allem gemeinschaftsbildend. Diese Überlegung von Eco weist auf eine wichtige gesellschaftliche Funktion von Serien hin. Dies darf in der Forschung nicht unterschätzt werden, da keine Gesellschaft und kein Mensch ohne ihre/seine identitätsstiftenden Erzählungen auskommt.
Bild 3: Filmserienanschauen, Privatbesitz
Zweite These:
Anschauen von Filmserien im Netz - dies ist eine Strategie der Lebensbewältigung
Das Anschauen der Serien findet immer in einer bestimmten Situation statt, es ist Teil des konkreten, eigenen Lebens. Der Akt der Rezeption wird mehr oder weniger aktiv, mehr oder weniger bewusst als Handlung eingesetzt, um mit dem Leben und der konkreten Situation fertig zu werden. Aber genau das ist es, was eigentlich Kultur ausmacht: die Möglichkeit, Sinn, Freude, Kraft und Kontinuität im Leben zu finden. Kultur als „Rettungsbewegung mit den Armen" - so hat es einmal José Ortega y Gasset ganz poetisch genannt [8, s.9]. Kultur als Strategien der Lebensbewältigung - so können wir es etwas wissenschaftlicher formulieren. Kultur hat immer etwas zu tun mit den Suchbewegungen mit denen Menschen ihre Vorstellung von gutem und richtigem Leben in Alltagsdenken und -handeln übersetzten [9].
Hier einige Auszüge aus der Befragung, die deutlich zeigen, wie Serienschauen von unseren jungen Erwachsenen eingesetzt wird, um mit dem Leben, so wie es sich konkret und momentan zeigt, fertig zu werden:
Person A. Donnerstagabend Kinder endlich im Bett Ruhe scheint einzukehren
Ich setzte mich mit meinem Freund zusammen und wir schauen
2 Folgen von der Serie, die wir verfolgen, ich schlafe ein.
Person B.
Gestern haben wir beim Abendessen eine neue Serie ausprobiert. „The Widow". In der Beschreibung stand, eine Frau würde ihren Mann, der im Kongo verschollen ging, suchen. Das klang für uns ganz spannend. Es gibt hiervon 10 Folgen mit ca. 30-50 Minuten Spieldauer je Folge. Normalerweise schauen wir am Wochenende abends gern einen Film. Aber diese Serie war so spannend, dass wir nach dem Abendessen weiter geschaut haben, insgesamt 3 Folgen. Etwas unangenehm war hierbei, dass die Spannung fast unerträglich wurde. Als Zuschauer hatte man die ganze Zeit einen gesteigerten Adrenalin-Spiegel. Das war etwas anstrengend. Und obwohl wir gerne weiter geschaut hätten, haben wir nach
3 Folgen unterbrochen, da wir auch noch etwas private (Arbeit) besprechen wollten. Dafür haben wir uns danach noch Zeit genommen.
Person C.
Da ich die erste Staffel „Charité" gesehen habe und diese mir gut gefallen hat, wollte ich auch die gerade neu erschienene zweite Staffel sehen. Ich bin in Elternzeit und hätte gerade gedacht, dass man dann auch tagsüber mal Zeit für so etwas hat. Als ich also die erste Folge angefangen habe, saß ich gemütlich mit dem schlafenden Baby auf dem Sofa. Der Ton war, um das Baby nicht zu stören, allerdings so leise, dass ich wichtige Passagen zum Teil nicht richtig verstehen konnte, hin- und her- spulen und mich stark konzentrieren musste. Das war anstrengend und störte das Filmerlebnis. Geschafft habe ich bisher nur zwei Folgen. Person D.
Vor kurzem war meine Schwester zu Besuch. Ich hatte im Internet von einer Dokumentation über Michael Jackson gelesen, die in den USA großes Aufsehen erregt hat, da dieser in der Serie von zwei mittlerweile
erwachsenen Männern des sexuellen Missbrauchs beschuldigt wird. Da Michael Jackson so eine riesige Ikone war und sich gleichzeitig immer schon Gerüchte und Mythen um ihn rankten, hat uns
die Doku sofort total interessiert. Natürlich auch wegen dem riesigen Aufschrei, den die Doku in den USA ausgelöst hat. Da das Wetter schlecht war, haben wir uns in mein Bett gelegt und direkt den ersten Teil auf meinem Laptop angeschaut. Wir mussten die Doku über eine illegale Streaming Seite anschauen, da sie nicht auf Netflix oder Amazon verfügbar war. (...) Wir haben uns dann am nächsten Tag schon morgens beim Frühstück darauf gefreut später den zweiten Teil der Doku anzuschauen. Wir haben uns während des Schauens, aber auch danach noch viel über die Doku ausgetauscht. Ich habe die Doku auch bereits Freunden empfohlen.
Person E.
Das letzte Mal habe ich mir gemeinsam mit einer anderen Person einen Film auf einem Tablet angeschaut, eher kleiner Bildschirm, im Bett liegend. Der Film hat mich vom Thema her nicht herausragend begeistert, aber die andere Peron wollte mir diesen Film unbedingt zeigen. Da ich sehr müde war, bin ich nach 30 Minuten eingeschlafen. (...) Wenn ich alleine gewesen wäre, hätte ich nicht einmal begonnen, den Film anzuschauen zu diesem Zeitpunkt. Doch da ich der anderen Person einen „Gefallen" tun wollte, habe ich nicht Nein gesagt.
Person F.
Gestern Abend mit meinem Freund.
Haben ein ziemlich schweres Gespräch gehabt über unsere Beziehung und unsere Zukunft.
Eine Entscheidung steht an, die sehr schwerfällt.
Worte haben an einem Punkt keinen Sinn mehr gemacht.
Wir waren müde, und überfordert.
Danach habe ich einen Film ausgesucht und wir haben uns den zusammen Arm in Arm im Bett angesehen und zusammen gelacht und auch mal geweint.
Und es hat und einander nähergebracht (körperlich wie auch mental) und auf das Wesentliche zurückgeführt... nämlich das Glück was wir haben hier und jetzt zusammen zu sein.
Der Film war so gut, dass er uns rausholen konnte aus unseren momentanen Problemen und Sorgen und uns eine größere Sicht auf das gegeben hat, worum es im Leben ankommt
Danach sind wir Arm in Arm eingeschlafen ;)
Bild 4: Filmserienanschauen, Privatbesitz
Dritte These:
Das Anschauen von Filmserien geht einher mit einer Steigerung der Bedeutung des eigenen Lebens. Dies bedeutet einerseits Erweiterung der persönlichen Freiheit und Unabhängigkeit, zugleich aber auch eine neue Begrenzung und Limitierung der Handlungsfähigkeit.
Wie bereits ausgeführt charakteristisch für das Serienschauen ist, dass der Rezipient allein über alle Parameter der Rezeption entscheidet: wann, wo, was, wie lange, mit wem Filme angeschaut werden. Es handelt sich um eine aktive, zielgerichtete, mehr oder weniger bewusste Handlung. Dies ist als eine neue Form von Freiheit und Unabhängigkeit zu sehen. Genau dieser Aspekt wird von den jungen Leuten als besonders wichtig eingeschätzt. Er steht in engem Zusammenhang mit anderen Erfahrungen und Bedürfnissen der jungen Leute heute, die in Richtung einer stärkeren Gewichtung des eigenen Lebens gehen.
In der Forschung wurde das Phänomen der neuen Gewichtung des eigenen Lebens Ende der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts ins Zentrum des Interesses gerückt. Beispielhaft für diese Diskussion finde ich das Buch des Soziologen Ulrich Beck „Eigenes Leben. Ausflüge in die unbekannte Gesellschaft, in der wir leben". Das Buch fängt so an: „Es gibt im Westen der Welt wohl kaum einen verbreiteteren Wunsch als den, ein eigenes Leben zu führen" [10, s. 9]. Beck weist auf einige wesentliche Momente dieses Strebens nach eigenem Leben: Es ist ein Zwang und eine Möglichkeit, die mit der hochdifferenzierten Gesellschaft zusammenhängt. Zudem ist das eigene Leben nicht frei von der Gesellschaft, sondern Ausdruck einer späten, postmodernen Form der Vergesellschaftung. Ein wesentlicher neuer Moment hier ist die grundlegende Reflexivität, was dem Einzelnen abverlangt wird. Deshalb sprechen wir in der Theorie auch von einer reflexiven Moderne, wenn wir dabei sind die aktuelle Zeit zu beschreiben. Weiter: Das eigene Leben ist institutionsabhängig und fordert von Einem eigenständige Aktivität, um sich hier zu situieren, ja um hier zu bestehen. Aspekte der fortschreitenden Globalisierung mischen sich dabei genauso ein wie Tendenzen der Endtraditionalisierung und Prozesse der Erfindung neuer Traditionen. Einige Entwicklungen im kulturellen Bereich können wir unter den Stichpunkt Hybridisierung und hybride Kulturen zusammenfassen [11]. All diese Prozesse gehen durch das Individuum hindurch, welches dies zusammenhält und meistert. Es ist ein lebenslanges Experiment, das viel Reflexion und vermehrt eigene Entscheidungen abverlangt. Das Schauen von Filmserien auf digitale Medien ordnet sich in diesen Kontext ein.
Andererseits dürfen wir nicht vergessen, dass das, was im Netz oder auf den anderen digitalen Medien angeboten wird weitgehend limitiert ist und bestimmten Gesetzten und Einschränkungen folgt. Der Rezipient bekommt immerzu neue Angebote, die oft aber sehr ähnlich sind und was noch wichtiger ist, sie arbeiten alle nach den Regeln und nach den Bedingungen der Branche, in der die Filmserien hergestellt und vertrieben werden. Die Serien selbst, so wie das Internet auch, haben spezifische Grenzen und Einschränkungen, die nicht ohne weiteres aufgehoben werden können. Wir können diese Grenzen und Einschränkungen mindestens auf drei Ebenen untersuchen:
betreffend die technischen Möglichkeiten,
betreffend die ökonomischen Möglichkeiten,
betreffend die ideologischen, politischen und anderen geistigen
Modalitäten in der Gesellschaft.
Wir haben hier ein weites Feld in der Kulturwissenschaften, doch bereit jetzt lässt sich sagen, dass diese drei Ebenen eng zusammenhängen und erst die geistige Reife einer Gesellschaft den Bedarf an neue Techniken und entsprechende wirtschaftliche Strukturen einher leitet. Es lohnt sich dies näher zu untersuchen, doch wir dürfen uns nicht irren: die neue Freiheit und Unabhängigkeit, so wie sie sich heutzutage zeigt, ist eine eingeschränkte Freiheit und eine weitgehend limitierte Unabhängigkeit.
Hier als Denkanregung einen Auszug aus der Befragung:
Person G:
Serien, Youtube Clips.
Oft bekommt man am Ende eines Clips themenrelevante Clips angeboten und schaut so einfach weiter. Bei den Serien Streaming Plattformen funktioniert das ähnlich. Deshalb ist der Trend hin zu mehreren Serien/Clips hintereinander anschauen.
Kürzlich habe ich mir auf YouTube eine Dokumentation über Vulkane angeschaut. Über Vorschläge von YouTube habe ich am Ende auch Dokus über Plattentektonik und den Erdkern gesehen. Man taucht in ein Wissens Universum ein und hat das Gefühl unbegrenzt Themen rund um das Hauptthema konsumieren zu können. Faszinierend und zeitfressend zugleich.
Die Beziehung zwischen Freiheit und digitale Revolution ist eine der großen Fragen der heutigen Zeit. Um an dieser Frage heranzukommen werden wir neue gesellschafts-politische Utopien brauchen, denn ohne eine Utopie bzw. Geschichten und Erzählungen darüber lässt sich keine Zukunft gestalten. Einen beachtlichen Versuch in dieser Richtung finden wir in dem neuen Buch von Richard David Precht „Jäger, Hirten, Kritiker. Eine Utopie für die digitale Gesellschaft" [12]. Der Autor bemängelt hier das Fehlen einer gesellschaftlichen Utopie-Fähigkeit und UtopieBereitschaft. Dadurch wird laut Precht der Fortschritt allein der Technik
und der Ökonomie überlassen, was gefährliche Folgen hat. Das Buch endet mit einem Plädoyer darüber, wie wir die engen Grenzen unseres gegenwärtigen Gesellschaftsmodells hinauszudenken vermögen und realistische Bilder einer lebenswerten Zukunft entwerfen könnten, in der nicht die Technik, sondern die Humanität im Mittelpunkt steht.
Ein anders Plädoyer findet sich in ein etwas älteres Buch von Tzvetan Todorov mit dem Titel „Abenteuer des Zusammenlebens. Versuch einer allgemeinen Anthropologie". Hier Tzvetan Todorovs Argumentationslinie: "Die Geselligkeit ist nichts Unwesentliches oder Zufälliges, sondern die Grundbestimmung der Conditio humana" [13, s.26]. Dann weiter: „Der Mensch ist aus den Beziehungen zu seinen Mitmenschen gebildet (...) das menschliche Wesen ist gleichsam ein Kollektivsingular." Und nicht zuletzt: „Das Selbst existiert nur in seinen und durch seine Beziehung zu den anderen; den gesellschaftlichen Austausch zu intensivieren, heißt des Selbst zu bereichern. (...) Ein jeder hat das Recht zu existieren, und er erheischt dazu den Blick des anderen. Denn das Dasein misst sich nicht in Begriffen von gut oder schlecht, sondern nach Glück und Unglück" [13, s. 167-172].
Ich würde gern mit der Vision einer intersubjektiven Kulturforschung abschließen, wofür neben Tzvetan Todorov so unterschiedliche Autoren und Autorinnen wie Michail Bachtin, Julia Krasteva, Martin Buber, Margaret Mitscherlich, Emmanuel Levinas, Simone de Beauvoir, Charles Taylor, Jürgen Habermas und viele mehr vorgearbeitet haben. Hier nochmal Tzvetan Todorov: „Die Beziehung zu anderen ist aber nicht das Produkt der Interessen eines Selbst, sie ist sowohl dem Interesse wie dem Selbst vorgängig. (...) Die Menschen leben nicht aufgrund von Interessen, aus Tugend oder sonst irgendeinem starken Grund in Gesellschaft. Sie tun es, weil es für sie keine andere mögliche Daseinsform gibt" [13, s. 17].
Es ist an der Zeit diese Diskussion mit der Debatte über die digitale Revolution zu verbinden. Bis jetzt gibt es in der Theorie wenig Schlüssiges in dieser Richtung, doch Ideen und Visionen sind bereits im Umlauf. Für die prominente Primatologin/Verhaltensforscherin Sarah Blaffer Hrdy besteht der wohl markanteste Unterschied zwischen uns Menschen und
allen anderen Menschenaffen in unserer viel ausgeprägteren Fähigkeit, uns in andere einfühlen zu können und uns entsprechend umgänglich und kooperativ zu verhalten. Vielleicht wäre das eine Anregung, wenn wir über „künstliche Intelligenz" und „Menschenroboter" nachdenken. Ist es nicht bezeichnend, dass wir über „künstliche Intelligenz" sprechen und bereits auch solche Maschinen kennen, doch kaum über „künstliche Emotionalität", bzw. „künstliche Empathie"? Geht das überhaupt? Hier öffnet sich ein viel komplexeres und subtileres Feld, was die Kulturforschung erst zu erarbeiten hat. Vielleicht ist das, was uns als Menschen von den anderen Menschenaffen unterscheidet - um hier an Blaffer Hrdy anzuknüpfen — nicht viel anders als das, was uns von den Maschinen und allen Roboter unterscheidet. Es lohnt sich darüber nachzudenken.
Sarah Blaffer Hrdy zitiert in ihren profunden Buch „Mütter und Andere: Wie die Evolution uns zu sozialen Wesen gemacht hat" [14] einen Graffiti Aufschrift, wo die Verbindung zwischen digitale Revolution und Intersubjektivität auf so visionäre und witzige Weise ausgedrückt wird. Der anonyme Sprayer hat auf einer Wand seine Botschaft hinterlassen:
„In der Zukunft wird jeder einen schnellen Internetzugang und eine Oma brauchen."
(Anonymus)
REFERENCES
1. Lückerath T. Binge-Watching: Ein Trend, der linearem TV schadet? DWDL. de-Archiv, Archivmaterial von 25.09.2013.
URL: https://dwdl.de/sl/a34a9f (accessed 21.06.2019).
2. Tschernokoshewa E. Der Film - eine neue Kunst und seine theoretische Reflexion. Probleme ästhetischer Theoriebildung, untersucht am Modell der Stummfilmtheorien, Dissertation. Manuskript. Humboldt-Universität zu Berlin, 1976.
3. Benjamin W. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Frankfurt/Main: Suhrkamp Verlag, 1963. 160 s.
4. Populäre Serialität: Narration - Evolution - Distinktion Zum seriellen Erzählen seit dem 19. F. Kelleter (Hg.). Jahrhundert: Transkript Verlag, 2012. 408 s.
5. Serialität und Moderne Feuilleton, Stummfilm, Avantgarde. D. Winkler, M. Stemberger, I. Pohn-Lauggas (Hg.). Bielefeld: Transcript Verlag, 2018. 274 s.
6. Eco U. Serialität im Universum der Kunst und der Massenmedien. Im Labyrinth der Vernunft. Texte über Kunst und Zeichen. M. Franz, S. Richter (Hg.). Leipzig: Reclam, 1999, S. 301-324.
7. Chernokozheva E. Razvlechenie i kultura [Entertainment and culture]. Sofiya: Nauka i Izkustvo, 1987. 196 p.
8. Ortega y Gasset J. Um einen Goethe von innen bittend. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1951. 50 s.
9. Tschernokoshewa E. So langsam wird's Zeit. Bericht der unabhängigen Expertenkommission zu den kulturellen Perspektiven der Sorben in Deutschland. Bonn: ARCult, 1994. 220 s.
10. Beck U. Eigenes Leben. Skizzen zu einer biographischen Gesellschaftsanalyse. U. Beck, W. Vossenkuhl, U.E. Ziegler. Eigenes Leben. Ausflüge in die unbekannte Gesellschaft, in der wir leben. München: Verlag Beck, 1997. S. 9-20.
11. Tschernokoshewa E. Hybride Welten, Bücherreihe, (Herausgeberin), Bd.1 bis Bd.8. Münster; Berlin; New York: Waxmann Verlag, 2000-2015.
12. Precht R.D. Jäger, Hirten, Kritiker. Eine Utopie für die digitale Gesellschaft. München: Verlag Goldmann, 2018. 288 s.
13. Todorov T. Abenteuer des Zusammenlebens. Versuch einer allgemeinen Anthropologie. Berlin: Verlag Wagenbach, 1996. 188 s.
14. Blaffer Hrdy. S. Mütter und Andere. Wie die Evolution uns zu sozialen Wesen gemacht hat. Berlin: Berlin Verlag, 2010. 544 s.
ÜBER DEN AUTOR: ELKA TSCHERNOKOSHEWA
Dr. phil. habil.,
Mitbegründer und Mitglied der Europäisch Assoziation Kulturforschern e.V. (ERICarts Network) Ulmenallee 24a, D-50999 Köln, Deutschland ORCID: 0000-0002-5589-3841 e-mail: elkahome@gmx.net
ABOUT THE AUTHOR: ELKA TCHERNOKOJEVA
Dr. phil. habil.,
Co-founder and Member of the European Association of Cultural Researchers e.V. (ERICarts Network) Ulmenallee 24a, D-50999 Cologne, Germany ORCID: 0000-0002-5589-3841 e-mail: elkahome@gmx.net





 CC BY
CC BY 33
33